Der Geschäftsführer der Hentschke Bau GmbH spricht im Interview über soziale Verantwortung, regionales Engagement und die Umsetzung in der Praxis
Schon seit vielen Jahren macht sich die sächsische Hentschke Bau GmbH durch gesellschaftliches und soziales Engagement für die Region stark, fördert und unterstützt Sportvereine, Jugendfeuerwehren, Projekte für Kinder, für Kunst und Kultur, für Bildung und vieles mehr. Im Interview spricht Hentschke-Bau-Geschäftsführer Jörg Drews über das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) und deren konkrete Umsetzung in der täglichen Praxis.
Hentschke Bau fördert ja sehr viel. Nach welchen Kriterien wählen Sie Vereine oder Initiativen aus?
Unser Hauptaugenmerk liegt auf regionalen Projekten. Wir fördern dort, wo wir und unsere Mitarbeiter zu Hause sind. Zudem bekommen wir auch direkte Anfragen von Mitarbeitern oder ihren Familien, die in den jeweiligen Vereinen unterwegs sind und sich dort gesellschaftlich engagieren. Diese Anfragen werten wir aus und helfen da, wo wir helfen können.
Gibt es spezielle Kriterien – etwa die Gemeinnützigkeit oder den Schwerpunkt Sport? Und wer entscheidet, welche Projekte gefördert werden?
Die Entscheidung liegt im Wesentlichen bei mir. Wir unterstützen all das, was wir als unterstützenswert empfinden. Wir unterstützen keine Abiturfeiern oder Ähnliches, sondern vielmehr dort, wo Hilfe wirklich notwendig ist. Wir helfen auf sehr unterschiedliche Weise – überall da, wo wir das Leben vereinfachen oder verbessern können. Der Schwerpunkt richtet sich vor allen Dingen auf Kinder, Jugendliche und alle Begegnungsstätten, an denen sie sportlich und gesellschaftlich unterwegs sind. Das geht vom Sport über die Jugendfeuerwehr und Schulsternwarte bis hin zum Bautzener „ZUSEUM“, wo Kinder angehalten werden, zu experimentieren und zu basteln, wo sie also eine sinnvolle Freizeitgestaltung bekommen. Einmal etwa hat sich ein junges Mädchen an uns gewandt, das eine Behinderung hatte und eine Aufstiegshilfe für ihr Pferd brauchte. Da haben wir in unserer Tischlerei eine Aufstiegshilfe gebaut und dem Mädchen übergeben.
Warum machen Sie das? Sie sind ja auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Was also sind die Beweggründe?
Ich bin der Meinung, dass wir als eigenverantwortliche Personen und insbesondere als Unternehmer für unser Umfeld mitverantwortlich sind. Es nützt nichts, wenn man zwar selbst eine gewisse abgesicherte Basis hat, das Umfeld aber nicht lebenswert ist. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, selbst für ein lebenswertes Umfeld zu sorgen – dort, wo wir dies als Unternehmen können. Ich sehe das auch als Beitrag für unsere Mitarbeiter, die hier wohnen. Wenn wir einen Fußballverein unterstützen, betrifft dies vielleicht sogar das Kind eines Hentschke-Mitarbeiters. Auf diese Art und Weise gibt man seinen Mitarbeitern etwas zurück, denn ohne deren Fleiß in der Firma wäre diese ja nicht die, die sie jetzt ist.
Also ist es auch ein Stück weit dafür, das Unternehmen weiter attraktiv für die Mitarbeiter zu gestalten?
Es steigert unsere Attraktivität als Arbeitgeber und lässt die Mitarbeiter spüren, dass man als Unternehmen zwar gewinnorientiert ist, aber auch gesellschaftlich etwas beiträgt und zurückgibt. Wir tun dies natürlich auch, um das Engagement unserer Mitarbeiter zu würdigen, indem wir uns für ihre Belange auch außerhalb des Unternehmens engagieren.
Ist es üblich in Ihrer Branche, dass man sich so engagiert? Oder ist Ihr Unternehmen da in einer besonderen Position?
Das Engagement hängt natürlich in Teilen davon ab, ob das Unternehmen es sich leisten kann. Es gibt ja gesetzliche Vorgaben, dass man nicht mehr an Spenden ausgeben kann, als man eigentlich verdient. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich in der Region auch einen Mehrwert erzeugen. Das merken wir zum Beispiel bei der Anwerbung von Jugendlichen für die Ausbildung und an der Qualität und Wertschätzung unserer Mitarbeiter. Wir haben mit dem, was wir tun, durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht.
Wird dieses Engagement auch diskutiert? Haben Sie da mal Feedback bekommen? Vielleicht nicht nur in Bezug auf einzelne Projekte, sondern auf das Engagement von Hentschke Bau ganz generell?
Ja, es wird diskutiert und es gibt durchaus auch mal eine Mitteilung von Mitarbeitern, die sich in den Vereinen eingebracht haben. Dann bekommen wir etwa ein Foto zurück mit einem Dankeschön, auf dem die Dinge zu sehen sind, die wir unterstützt haben – etwa Spielgeräte, wenn wir Kindergärten unterstützen. Oder wir werden in die Publikationen der Vereine eingebunden und auch immer wieder zu Vereinsveranstaltungen eingeladen.
Würden Sie sagen, dass engagierte Unternehmen hier Aufgaben übernehmen, die im weitesten Sinne im Bereich der Politik liegen?
Ja, durchaus. Nehmen wir zum Beispiel die Unterstützung des Breitensports. Im Schulbereich hat der Sportunterricht immer mehr abgenommen, während die Kinder zu Hause oft am Computer spielen und so immer weniger am sozialen Leben teilnehmen. Das Zusammenleben, das Durchsetzen und die körperliche Ertüchtigung, die der Sport mit sich bringt, werden dabei vernachlässigt. Gerade wir sind ein Betrieb, der Handwerker braucht – und ein Handwerker braucht eine gewisse körperliche Fitness. Damit hat unser Engagement für den Breitensport ein gewisses Eigeninteresse. Wir halten es aber auch ganz generell für wichtig, dass junge Leute durch Sport lernen, zu kommunizieren und sich durchzusetzen. Erfolg und Niederlage gemeinsam zu teilen, das macht soziales Zusammenleben doch erst aus. Zudem ist es so, dass wir hier eher eine Randregion sind. Wir haben sehr viele Betriebe, die nur eine verlängerte Werkbank sind. Wenige Unternehmen sind inhabergeführt, noch weniger haben die finanziellen Möglichkeiten, das, was wir tun, überhaupt zu leisten.
Gibt es für das, was sie tun, eine Ansprache aus der Politik? Etwa dergestalt, dass honoriert wird, was Sie leisten? Und gibt es kommunalpolitisch oder landespolitisch Anfragen mit der Bitte, mehr zu tun?
Das ist sehr schwierig. Direkte Forderungen von Seiten der Politik kann es ja an ein Unternehmen nicht geben. Es gibt natürlich manchmal den Hinweis auf ein Projekt, das unterstützenswert ist, aber in der Regel kommt nichts über die Politik. Ich trenne das auch ganz klar. Wenn Sie sich mit unserem Unternehmen beschäftigt haben, dann haben Sie vielleicht auch mal gelesen, dass mir insbesondere von politischen Gegnern vorgehalten wurde: Ich würde die Stadt mit meinem Engagement beeinflussen bzw. kaufen. Es gibt Artikel mit dem Titel: „Die gekaufte Stadt“. Dem ist aber nicht so, und dem will ich ganz klar widersprechen. Deswegen ist es eigentlich eher der unmittelbare Kontakt der einzelnen Beteiligten, die Politik bleibt außen vor. Auch mit NGOs habe ich eigentlich nichts zu tun. Ich habe eher die Vermutung, dass es die eine oder andere NGO gibt, die unser Engagement nicht befürwortet, aber das interessiert mich nicht.
Es gab ja zum Beispiel die bewusste Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bezug auf die Europawahl, in der sie den Wunsch äußerte, dass sich Unternehmen mehr beteiligen. Merkel hat dies in internen Kreisen, aber auch bei BDI-Empfängen gesagt. Gibt es denn Situationen, in denen etwa der Bürgermeister sagt: „Wir haben ein Stadtfest, könnt ihr uns da unterstützen?“
Nein. Wenn mich Politiker unmittelbar zu diesen Themen fragen oder gar auffordern würde, dann würde ich das nicht tun. Wenn aber ein Verein kommt und um Unterstützung bittet, dann gehen wir in den Abwägungsprozess. Ich versuche das strikt zu trennen. Unser gesellschaftliches Engagement besteht auch schon länger, als Frau Merkel Bundeskanzlerin ist. Ihrer Aufforderung hat es also bei uns nicht bedurft. Ich orientiere mich eher an der Geschichte. Selbst in der Vorkriegszeit bzw. in der Zeit vor 1920 waren es in der städtischen Entwicklung unserer Heimatstadt immer auch die Unternehmer, die der Region sehr viel zurückgegeben haben. Deshalb sehe ich eine Verpflichtung eher in der Tradition der Unternehmer und weniger in der Aufforderung der Politik.
Eine unternehmerische Verantwortung für das nahe Umfeld ist ja nichts radikal Neues. Nehmen wir etwa ThyssenKrupp: Der Konzern hat Krankenhäuser gebaut, Sport und Schulen unterstützt. Ist das ein Trend, der jetzt wiederkommt? Glauben Sie, dass das für Unternehmen zum Pflichtprogramm wird?
Ob es ein Trend wird, weiß ich nicht. Ich sehe aber die Notwendigkeit. Ich habe zunächst von der Unterstützung im Sportbereich gesprochen, weil wir durchaus auch sportliche Mitarbeiter brauchen. Aber wir merken natürlich, dass es gerade für die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten wichtig ist, sich schon mal mit anderen auseinandergesetzt zu haben – etwa in einer Mannschaft im Sport. Da sammelt man Erfahrungen. Man muss einstecken können, man muss ausprobiert haben, wie man mit Menschen umgehen kann. Man muss die unterschiedlichen Typen von Menschen in den jeweiligen Situationen einmal erfahren und analysiert haben, um dann eine Art zu entwickeln, wie man mit ihnen umgeht und sie auch führt. Auf der anderen Seite stehen natürlich die gesellschaftlichen Belange: Wir wissen, welche Bedeutung zum Beispiel das THW oder die Feuerwehr haben. Wenn wir den Nachwuchs nicht unterstützen, werden diese gesellschaftlichen Aufgaben nicht mehr erfüllt. Die Politik stellt zwar die Anforderungen, wenn man aber vor Ort ist, sieht man die schlechten Ausrüstungen. Wir sehen also die Notwendigkeit, dass dringend geholfen werden muss. Und es kommt ja auch jedem Bürger selbst zugute, wenn beispielsweise in Notfällen eine solche Infrastruktur benötigt wird.
Die Politik setzt also den Rahmen und fordert das, was Sie gerade angesprochen haben. Aber Sie sehen, dass diese Strukturen nicht zufriedenstellend ausgestattet sind und durch die Politik nicht so unterstützt werden, wie es nötig wäre, um gut zu funktionieren. Ist hier also im weitesten Sinne Ihre unternehmerische Verantwortung gefragt, Unterstützung zu bieten, wo sie fehlt?
Genau. Wir wissen ja, dass die Politik jedes Jahr, vor allem im Wahlkampf, eine ganze Menge Lippenbekenntnisse abgibt. So heißt es, dass man sich als Bürger nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass nach der Wahl auch gilt, was vor der Wahl gesagt wurde. Aber in unserem regionalen Leben spielen das Miteinander, der gegenseitige Respekt, die Anerkennung und die Achtung vor dem, was jeder Einzelne in seinem Bereich leistet, eine entscheidende Rolle. Dies ist die Grundvoraussetzung für ein vernünftiges Zusammenleben. Auf der einen Seite ist es also der Wille, ein besseres Lebensumfeld mitzugestalten. Auf der anderen Seite ist es immer auch Eigennutz, denn ich lebe ja hier, meine Familie lebt hier, und ich möchte natürlich, dass die Region so attraktiv ist, dass auch meine Kinder und Enkel hierbleiben wollen. Ich will schließlich über all die Jahre nicht umsonst hart gearbeitet haben. Ich möchte, dass mein Betrieb als Familienunternehmen seinen Fortgang findet. Das funktioniert aber nur, wenn auch die Kinder der Überzeugung sind, dass das hier ein lebenswertes Umfeld ist.
Sie erwähnten eben, dass Ihr Engagement von NGOs möglicherweise nicht so befürwortet wird. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ich bin für viele ein Mann mit Ecken und Kanten, weil ich meinen eigenen Überzeugungen folge. Dann wird einem natürlich immer unterstellt, dass man sich nur engagiert, um bestimmte Einflussnahmen möglich zu machen oder bestimmte Interessen durchzusetzen. Das habe ich nicht nötig. Das Hauptgeschäft der Hentschke Bau GmbH ist der Brückenbau. Durch mein Engagement in Kindergärten haben wir aber noch keinen Auftrag für eine Brücke erhalten. Ich bin zwar in der DDR geboren, aber mit bäuerlichen Wurzeln und einer bürgerlichen Erziehung bin ich ein überzeugter Unternehmer, der den Wettbewerb schätzt. Für den Wettbewerb muss es faire Regeln für alle geben. Wenn ich von anderen verlange, dass sie mir gegenüber fair sind, dann muss ich das auch selbst vorleben.
Also gibt es die Unterstellung, dass Sie sich durch Ihr Engagement zum Beispiel staatliche Aufträge verschaffen?
Dass ich mir dadurch Vorteile verschaffe.
Behaupten das Wettbewerber, oder wer sagt das?
Ich bin parteilos, aber es kommt hauptsächlich aus politischen Lagern links der Mitte. Da gibt es wunderbar schöne Geschichten. Da haben wir zum Beispiel in der Stadt unseres Hauptsitzes zum Weihnachtsmarkt Weihnachtstannen aus Beton erstellt, als es um die Sicherung von Weihnachtsmärkten ging. Selbst da wurde mir unterstellt, dies würde ich nur tun, um die Gesellschaft zu spalten.
Dann birgt solch ein Engagement also auch Risiken?
Ich bin jetzt seit einem Jahr Stadtrat. Und ich bin in einer Stärke zum Stadtrat gewählt worden, die es zuvor noch nie in meiner Heimatstadt gab. Auf der einen Seite zeigt es natürlich, dass man mit dem, was man tut, eine große Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Gleichzeitig gibt es natürlich auch politische Neider und Gegner, die sagen: „Das ist er nur, weil er sich das alles erkauft hat.“
Das wird dann auch offen unterstellt?
Ja, auch in Social Media Kanälen und im öffentlichen Diskurs.
Führt Ihr Mandat im Stadtrat auch dazu, dass Ihr Unternehmen politisierter wird? Wird das im Unternehmen diskutiert, nach dem Motto: „Der Chef ist jetzt im Stadtrat“?
Ich trenne meine politischen Aktivitäten so gut wie möglich vom Unternehmen.
Wenn Sie da noch ein bisschen tiefer gehen, werden Sie sehen, dass ich schon seit längerem sehr politisch bin. Ich weiß, dass sich ein Unternehmen in einem politischen und wirtschaftlichen Umfeld bewegen muss. Dieses Umfeld bestimmt auch den Erfolg des Unternehmens, und damit reflektiert es auch auf die Mitarbeiter. Es geht nicht darum, jede einzelne Entscheidung transparent zu machen. Aber ich halte es für sinnvoll, den Mitarbeitern zu vermitteln, warum und weshalb man eine Entscheidung trifft, die manchmal vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar ist. Immerhin ist es mir gelungen, in meiner 30-jährigen Tätigkeit noch nicht ein einziges Mal wegen schlechter Lage Personal in Größenordnungen abbauen zu müssen.
Mit Entscheidungen meinen sie betriebliche Entscheidungen?
Ja, betriebliche Entscheidungen, zum Beispiel warum man sich in Bezug auf eine bestimmte wirtschaftliche Ausrichtung in die eine oder die andere Richtung bewegt. Ich bin der Überzeugung, dass nur Mitarbeiter, die auch wissen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, diese entsprechend im Unternehmen weiterführen.
Wenn Sie unter Ihr Engagement einen Strich ziehen würden, glauben Sie, dass es für Ihr Unternehmen insgesamt positiv ist beziehungsweise war? Oder würden Sie eher sagen, dass es problematisch war?
Es gibt ein altes Sprichwort: „Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Ich habe schon angedeutet, dass ich hinsichtlich der Wahl meiner Person zum Stadtrat viel Zuspruch erhalten habe. Und ich merke es auch, wenn wir hier in der Stadt als Firma, oder ich als private Person, bestimmte Projekte entwickelt und realisiert haben, wie das Bahnhofsgebäude, das wir gemeinsam mit einem Partner umgesetzt haben. Das war immer Thema in der Stadt: Der Bahnhof war eine Ruine, jetzt ist er ein moderner Punkt des Reisens und ein Behördenzentrum. Wenn die Menschen anschließend auf einen zukommen, dann sprechen sie den Dank auch aus für das Engagement bzw. für das, was man tut. Das ist das, was im Wesentlichen gegenüber den Anfeindungen überwiegt. Erfolg bringt nun mal Neider und Gegner mit sich, und Missgunst gibt es immer. Damit muss man lernen richtig umzugehen.
Sind denn auch Parteispenden etwas, von dem Sie sagen, dass es am Ende des Tages eine Form gesellschaftspolitischen Engagements ist? Etwas, was Sie für das Unternehmen getan haben oder wo Sie gesagt haben: „Das ist meine private Sicht als geschäftsführender Gesellschafter“?
Sie sprechen die AfD-Spende 2017 an?
Genau. Das findet sich vermehrt im Internet.
Dabei haben wir auch viel größere Summen an andere Parteien oder regionale Vertreter gespendet, von denen ich sage, dass es Persönlichkeiten sind, die ihren Beitrag leisten und deren Unterstützung ich für wichtig halte, damit sie in der Gesellschaft vorankommen. Zur AfD-Spende: Ich hielt es damals für wichtig, dass an der Einhaltung der Gründungsabsprachen der Europäischen Union und vor allem des Euros festgehalten wird. Da gab es zum Beispiel die Haftungsklausel der Länder untereinander, dass das ausgeschlossen ist. Solche Dinge sind wichtig für die Unternehmen. Wenn durch Haftungsübernahme die Staatsverschuldung unseres Landes steigt, dann sinken in der Regel die Investitionen. Das hat Auswirkungen auf Unternehmen und vor allem auf Bauunternehmen, die auf staatliche Investitionen angewiesen sind. Ich hielt dies für grundlegend falsch. Wir werden in Kürze sehen, insbesondere jetzt im Rahmen der Corona-Krise, was da alles falsch gemacht wurde.
Würden Sie noch einmal spenden?
Die Frage stellt sich nicht. Ich bin der Meinung, dass es zu der Zeit richtig war. Damals war es die einzige Partei, die sich in diese Richtung überhaupt bewegt und entsprechende Fragen gestellt hat. Ich bin auch nicht der Typ, der sich mit dem Blick zurück aufhält, sondern eher jemand, der versucht, den Blick nach vorn zu wagen.
Erwarten Sie von Ihrem sozialen Engagement unterm Strich auch einen ökonomischen Nutzen?
Ich weiß nicht, ob man das direkt als ökonomischen Nutzen bezeichnen kann, aber es ist auf jeden Fall wichtig für den Fortbestand des Unternehmens. Nur wenn ich mit die besten und bodenständigsten Mitarbeiter habe, hat das Unternehmen langzeitig Bestand und kann der Region wieder etwas zurückgeben. Ich würde es eher als einen Kreislauf des Nehmens und Gebens betrachten, der immer wieder zueinander reflektiert.
Wie wird sich das soziale Engagement denn in Zukunft gestalten?
Zunächst glaube ich, dass gerade einiges auf uns zukommt: und zwar die Abwicklung der Krise, die bereits 2008 begonnen hat. Das Missverhältnis zwischen Produktivität und Nettokaufkraft, das entstanden ist und das nur durch Schulden gedeckt wurde. Wenn dieser Überkapazitätenabbau jetzt erfolgt, wird das ein langwieriger Prozess, der in den Regionen noch spürbarer wird. Umso wichtiger wird es, dass wir versuchen, das zu erhalten, was erhalten werden kann, und dort zu unterstützen, wo die Politik nicht ihren Aufgaben nachkommt – wobei ich gerade dieses zentrale Umverteilungssystem nicht sonderlich befürworte. Als ThyssenKrupp entschieden hat, dass sie Wohnungen für ihre Angestellten brauchen, wussten sie ganz genau, was die Bedürfnisse ihrer Angestellten sind und wie so etwas ausgerichtet werden muss. Wenn in der heutigen Zeit aber alles aus zentralen Töpfen kommt, werden dazu erstmal Richtlinien verfasst. Über diese Richtlinien geht es in Unterverteilungen und dann werden Anträge gestellt, um das Geld wieder in die Regionen zurückzuholen. Und wenn diese Förderungen bzw. Richtlinien auch noch so formuliert sind, dass sie daneben gehen und nicht den Kern treffen, dann sind die Prozesse einfach falsch. Sie sind überreguliert, überbürokratisiert und schaffen nur geringen Nutzen. Wir als Unternehmen hier in der Region wissen am besten, wo das Geld wirklich gebraucht wird. Die Unterstützung, die wir leisten, funktioniert schnell und unbürokratisch.
Es geht ja auch viel Geld verloren durch diese Prozesse, durch die Bürokratie. Die Antragstellung muss ja irgendjemand machen, sie muss von jemandem geprüft werden …
Ja. Viel besser wäre es, das Geld vor Ort einzusetzen. Solange ich hier in der Bundesrepublik lebe, wurde immer gesagt: „Wir müssen mehr für die Bildung tun, wir müssen unsere Schulen besser ausstatten.“ Nun kann man sich in unserer Stadt über die Schulen nicht so sehr beklagen, aber der Lehrermangel und die Ausstattung mit neuer Kommunikationstechnik lässt doch noch zu wünschen übrig. Wir sprechen diese Themen schon seit Jahrzehnten an, aber sie werden nicht wirklich gelöst. Das ist das, was ungeduldig macht.
Glauben Sie denn, dass Sie als Unternehmer in Zukunft mehr in Richtung Politik arbeiten wollen, also mehr Kontakt haben wollen? Dann wäre das beispielsweise die Landespolitik, wenn wir über Bildung reden.
Es gab schon Anfragen. Auf der anderen Seite bin ich leidenschaftlicher Unternehmer. Ich merke schon als Stadtrat, dass Politik eine ganz andere Umgebung ist, als ein Unternehmen zu führen. Da gilt es, Mehrheiten zu organisieren usw. Es ist ein sehr großer zeitlicher Aufwand. Ich würde es daher bei der Kommunalpolitik belassen, weil ich denke, dass ich als erfolgreicher Unternehmer der Region wahrscheinlich mehr Unterstützung bieten kann, als wenn ich in die Politik gehen würde. Zudem haben es die Parteien schwer, im Parteiensystem zu überleben. Deswegen bin ich auch für ein Bürgerbündnis angetreten, um die Nicht-Parteizugehörigkeit zu gewährleisten. Das halte ich für eine moderne Form. Solange Engagement an eine Partei geknüpft ist, wird es das mit meiner Zugehörigkeit wahrscheinlich nicht geben.
Das ist aber eine persönliche Entscheidung?
Das ist eine persönliche Entscheidung.


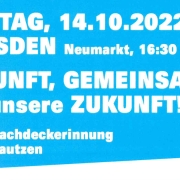

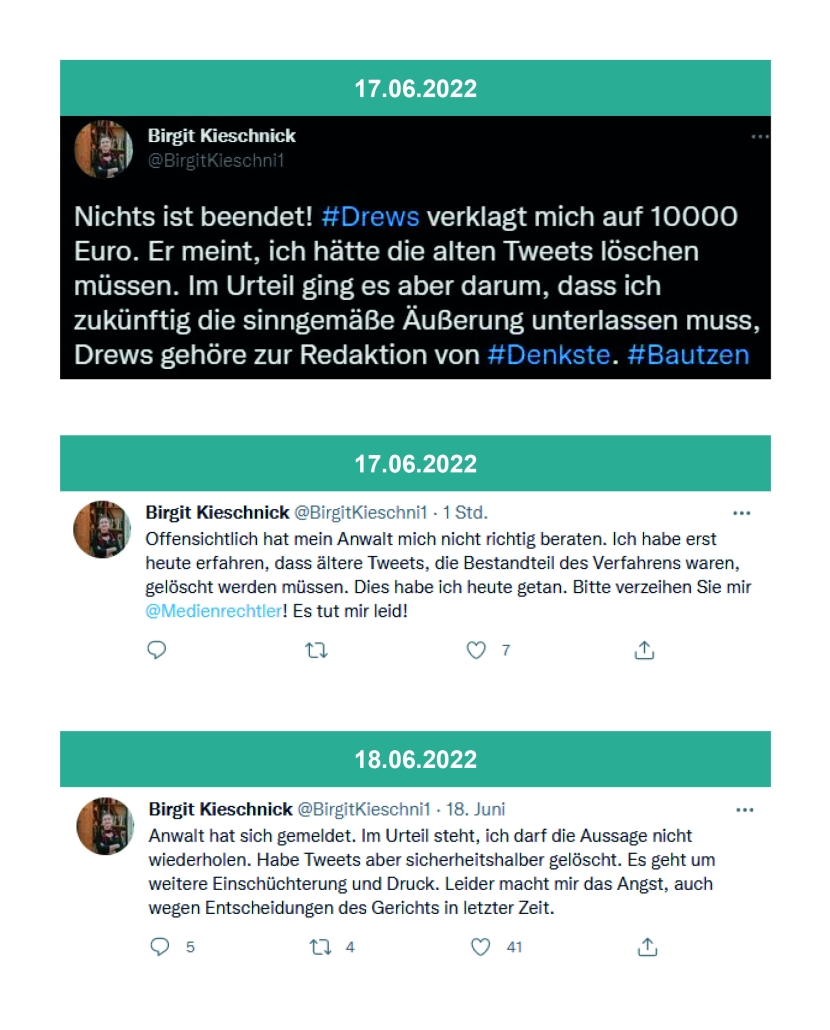


 Hentschke Bau GmbH
Hentschke Bau GmbH